Redaktion: Henrike Mölleken, Bernd Gehlken & Bernd Sauerwein A5, 288 Seiten+Tabellenanhang, 18,00 Euro/Abo 15,00 Euro
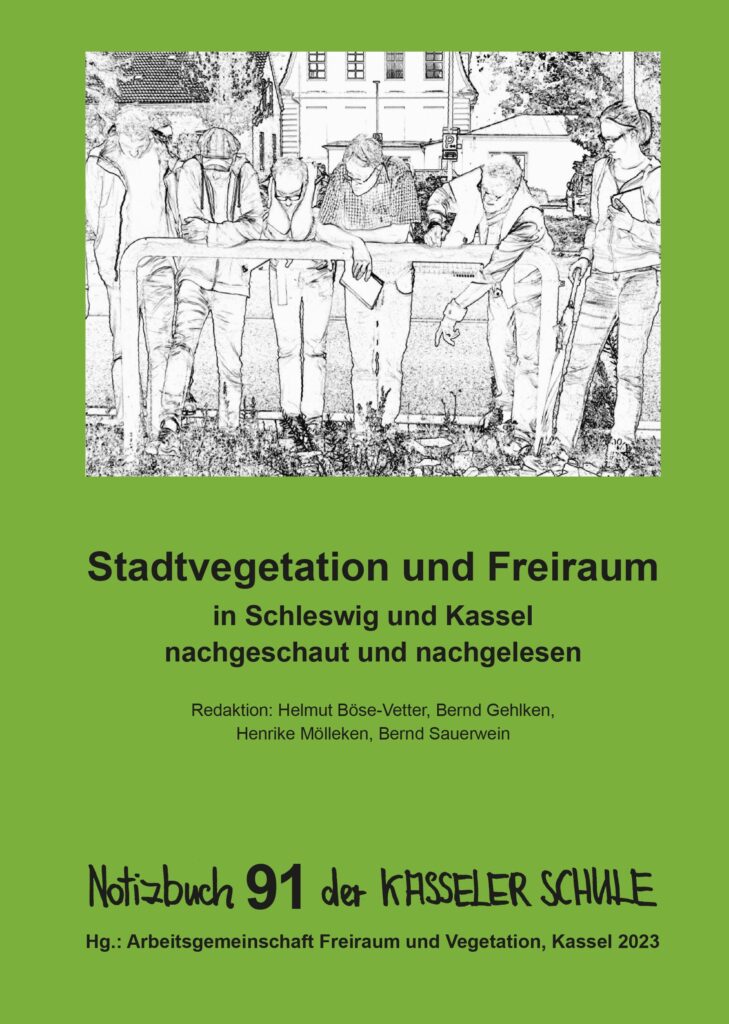
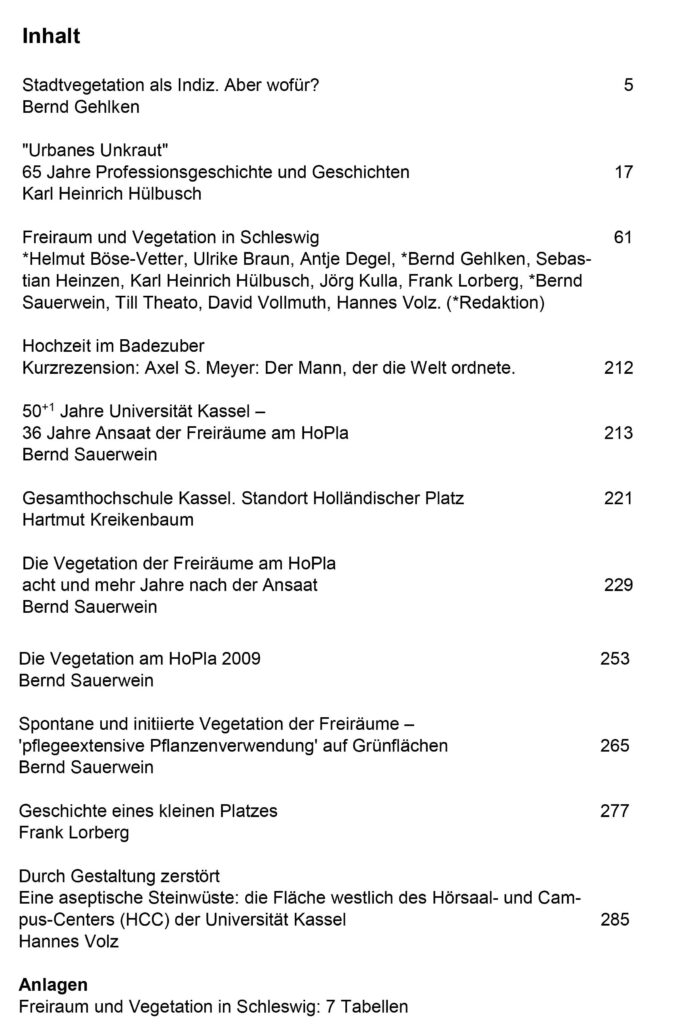
Redaktion: Henrike Mölleken, Bernd Gehlken & Bernd Sauerwein A5, 288 Seiten+Tabellenanhang, 18,00 Euro/Abo 15,00 Euro
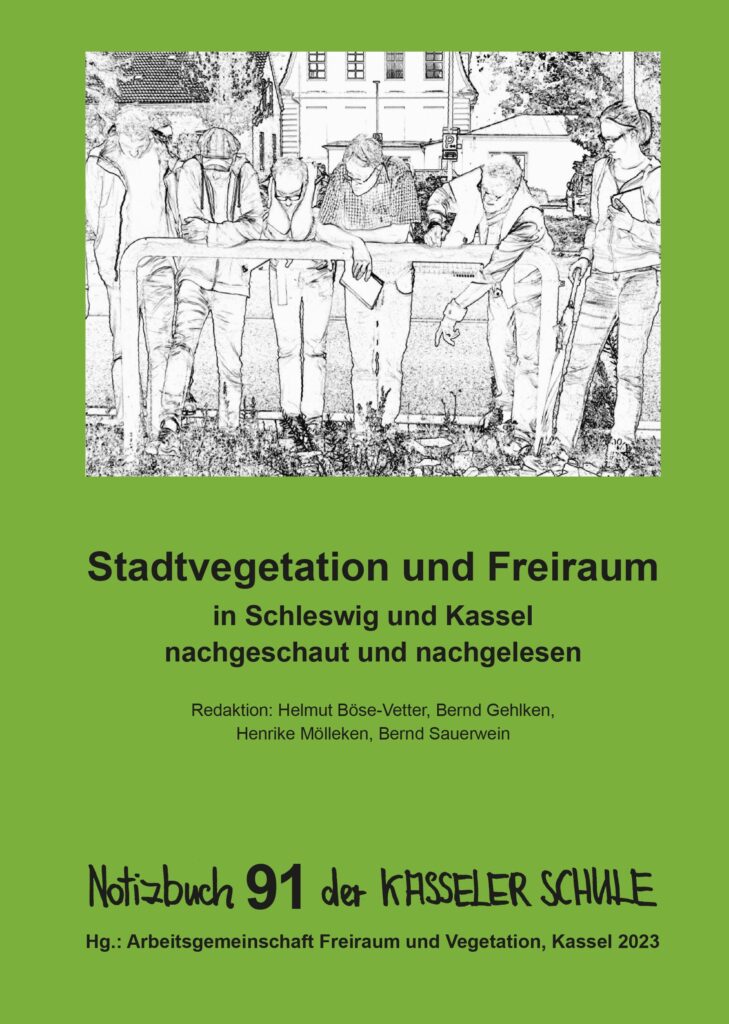
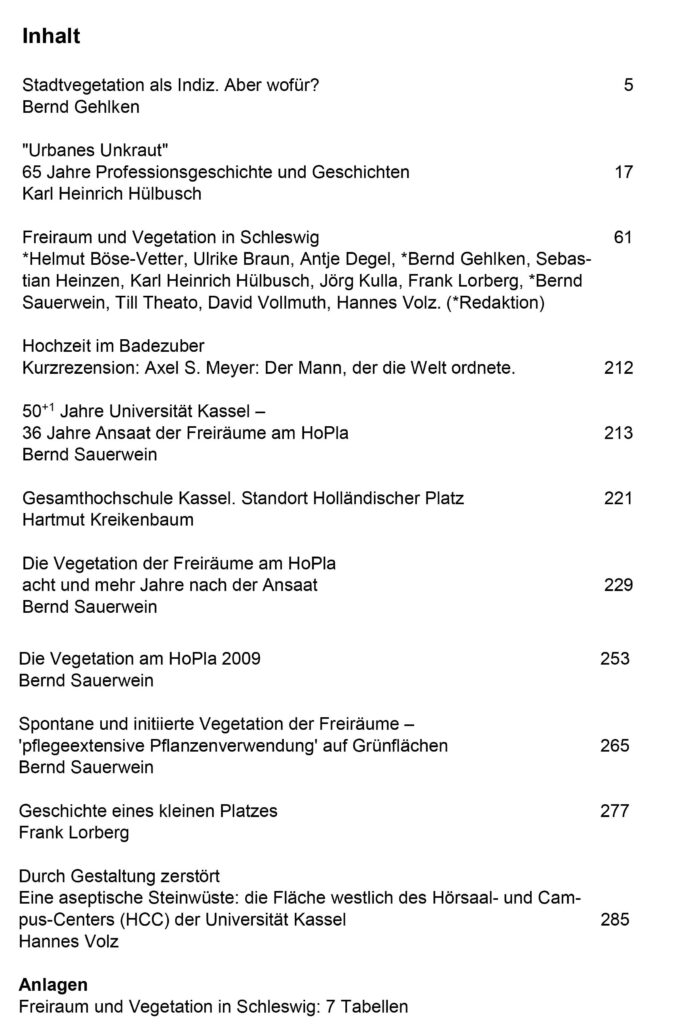
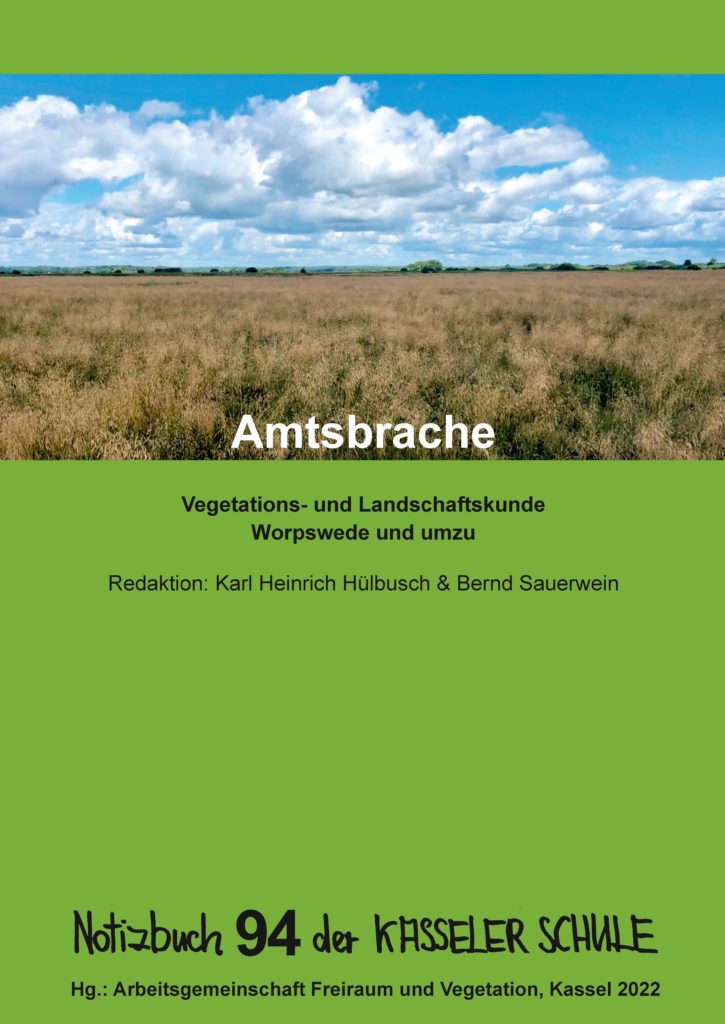
Redaktion: Karl Heinrich Hülbusch & Bernd Sauerwein A5, 248 Seiten+Tabellenanhang, 18,00 Euro/Abo 15,00 Euro
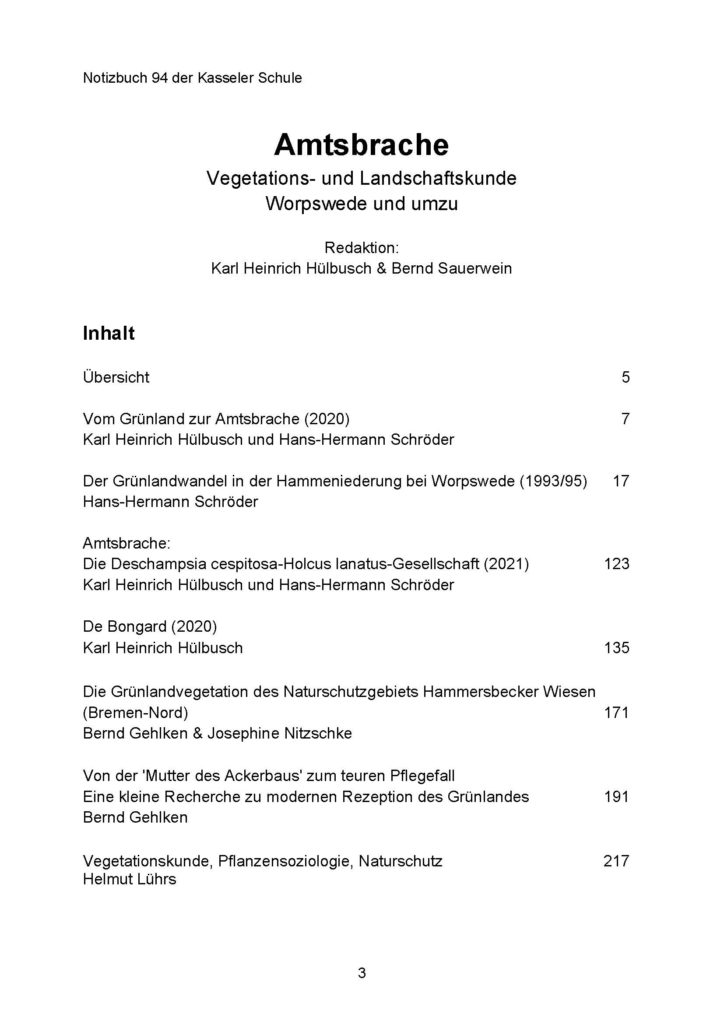
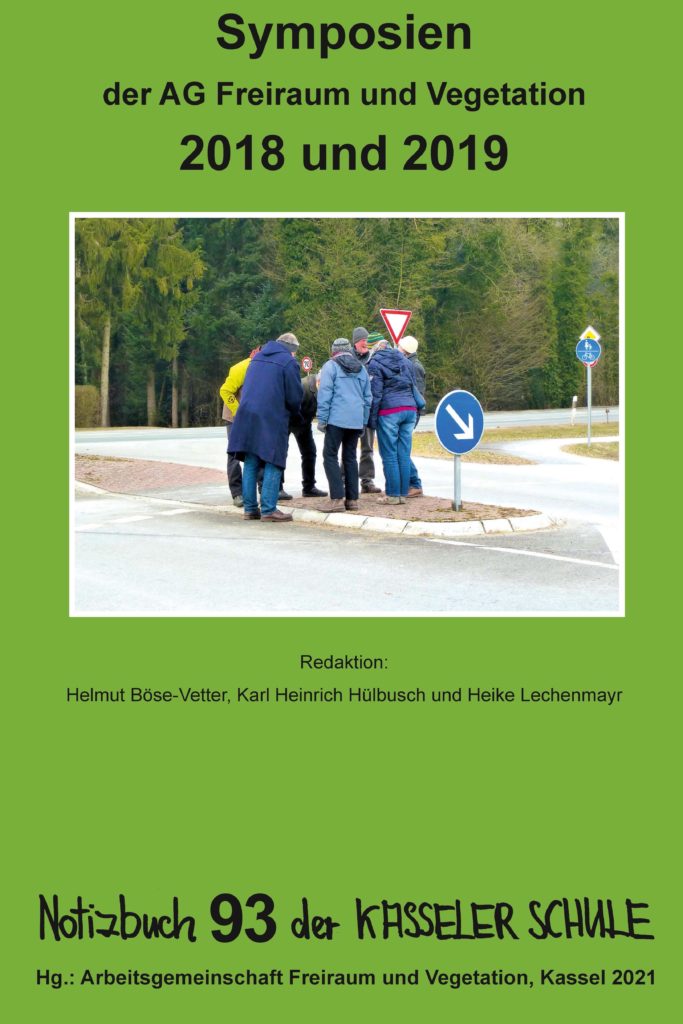
Symposien 2018 und 2019
Redaktion: Helmut Böse-Vetter, Karl Heinrich Hülbusch & Heike Lechenmayr A5, 252 Seiten mit farbigen Abbildungen, 18,00 Euro/Abo 15,00 Euro
INHALT
Käthe Protze: Ermutigungen, Zur Erinnerung an Inge Meta Hülbusch
Doris Damyanovic und Antonia Roither im Gespräch mit Inge Meta Hülbusch (2008): „Innenhaus und Außenhaus, Umbauter und sozialer Raum“
Karl Heinrich Hülbusch: Spaziergang – natürlich! ‘Spaziergangswissenschaft’ ? So‘n Quatsch!
Helmut Holzapfel „Italien – Porträt eines fremden Landes“ Zum Buch von Thomas Steinfeld (2020)
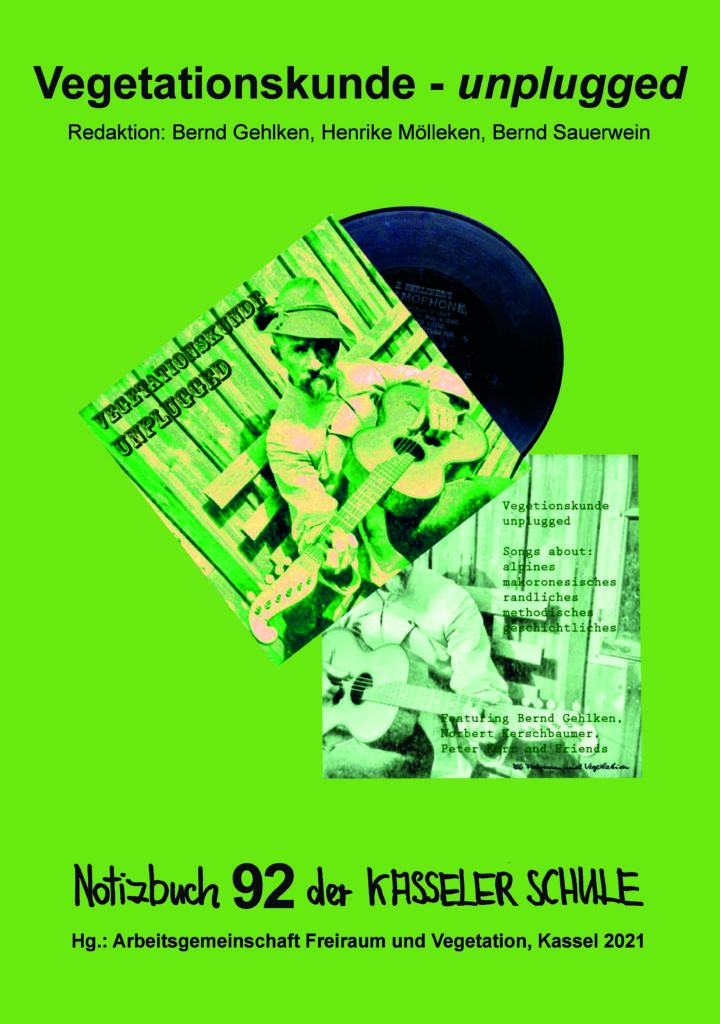
Redaktion: Bernd Gehlken,
Henrike Mölleken & Bernd Sauerwein A5, 230 Seiten+Tabellenanhang, 18,00 Euro/Abo 15,00 Euro
Inhalt
Booklet: Vegetationskunde unplugged
Bernd Gehlken & Bernd Sauerwein
Ein vegetationskundlicher Spaziergang auf der Alp Zanutsch
Bernd Gehlken
Alpendost-Hochstaudenfluren und Grün-Erlen-Gebüsche
(Betulo-Adenostyletea)
Bernd Gehlken*, Peter Kurz*, Maximilian Lübben, Michaela Puhr,
Eva Rechberger und Bernd Sauerwein* (*Redaktion)
Illyrische Kalkbuchenforsten und deren Ersatzgesellschaften
in der Vellacher Kotschna
Norbert Kerschbaumer & Peter Kurz
Trittgesellschaften auf La Gomera
Bernd Sauerwein
Cardiospermum grandiflorum-Schleierfluren auf La Gomera
Bernd Sauerwein
Beitrag zur Kenntnis des Torilidetum japonicae Lohmeyer ex Görs &
T. Müller 1969
Bernd Gehlken
Vom Kopf auf die Füße. Induktive Waldrandtypisierung
Bernd Gehlken
Die Magie der Zahl: Eine method(olog)ische Kritik an Ellenbergs ökologischen Zeigerwerten
Bernd Gehlken
Das Wirken Reinhold Tüxens und anderer Pflanzensoziologen in der Zeit von 1933 bis 1945
Bernd Gehlken
Die alte Brache. Rezension von Fred Pearce 2016: Die Neuen Wilden
Bernd Sauerwein
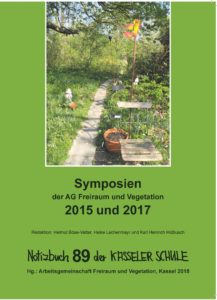 Symposien der AG Freiraum und Vegetation 2015 und 2017
Symposien der AG Freiraum und Vegetation 2015 und 2017
Grenzen, Ränder, Übergänge – Vor der Haustür
Helmut Böse-Vetter, Heike Lechenmayr und Karl Heinrich Hülbuch (Red.)
2018, A5, mit Anlage fast 250 S.
16,00 Eus (13,00 Eus ermäßigt).
Inhalt
 Notizbuch 87
Notizbuch 87
Vegetationskundliche Bastelarbeiten
von Reisen an die Oder, in den Fläming entlang von wegrändern und ins Armerion
Red: A. Blaß, B. Gehlken, B. Sauerwein
(2016) A5, ca. 108 Seiten, Beilagen
Mögliche Kategorisierungen oder gar Erklärungen sind zwar im Hinterkopf anwesend, dürfen aber den möglichst unvoreingenommenen Blick auf die realen Phänomene nicht verstellen. Für die ‚Benennung des Sichtbaren‘ spielt dessen Gefallen zunächst keine Rolle. Deswegen werden in den Notizbüchern – so auch in diesem – regelmäßig Pflanzengesellschaften abgebildet, die sehr weit verbreitet und ‚gewöhnlich‘ sind, wegen formaler ‚Mängel‘ aber in der pflanzensoziologis(tis)chen Literatur kaum oder gar nicht vorkommen. Seien es Äcker, denen sämtliche Kennarten ‚fehlen‘, ‚untypische‘ Wälder, ‚unvollständige‘ Magerrasen, irgendwelche anderen ‚Fragmente‘, ‚Relikte‘ oder gar völlig unanständige ‚Agroformen‘. Auch wenn es wenig sinnliches Vergnügen bereitet, artenarme Grasländer, herbizidbehandelte Maisäcker, monotone Kiefernforsten oder struppige Naturschutzbrachen aufzunehmen, so gehört auch und gerade die Beachtung dieser häufigen, floristisch aber völlig unspektakulären und ästhetisch eintönigen, Phänomene zur wissenschaftlichen Redlichkeit“ (aus dem Vorwort von Bernd Gehlken).
In diesem Sinne enthält das Notizbuch nicht nur Berichte einer vegetationskundlichen Reise an die Oder, mit Beschreibungen der Zwergbinsengesellschaften (Isoëto-Nanojuncetea) und Zweizahnfluren (Bidentetea) Zwergbinsengesellschaften vom Oderufer wie der Vegetation der Oderaue (Grünland: Allium angulosum-Gesellschaften, Rohrglanzgraswiesen, Flutrasen; der Verlandungsserie der Kolke; Euphorbia palustris-Gesellschaft, etc.) und zur Synsoziologie der Sandtrockenrasen (Diantho-Armenietum) sondern auch Berichte zur Vegetation in Turbo-Mais-Landschaften und zur Versaumung der Feldwegränder.
Über die Arbeit. Beiträge vom und zum Symposium
der AG Freiraum und Vegetat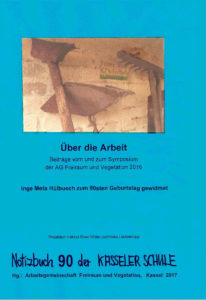 ion 2016
ion 2016
Inge Meta Hülbusch zum 80sten Geburtstag gewidmet.
Helmut Böse-Vetter & Heike Lechenmayr (Red.)
A5, 224 Seiten, 14,00 Euro/Abo 11,00 Euro
Zum 80sten Geburtstag von Inge Meta Hülbusch, der wir dieses Notizbuch widmen, haben wir drei ihrer Texte und eine Bibliographie ihrer Schriften in dieses Notiz-buch aufgenommen, die nicht zufällig zum Thema ‚Arbeit‘ und ‚Ertrag‘ gehören.
Wer sich die Literaturliste der Veröffentlichungen von Meta Hülbusch ansieht, stößt auf gleich drei Schwergewichte, die mit ihrem Namen verbunden sind, wo andere bereits mit einem hochzufrieden wären: „Leberecht Migge“, „Innenhaus und Außenhaus“, „Spurensicherung“. Nicht zu vergessen „Frauen und Gärten“, „Müttermanifest“, streitbare Bürgerinitiativlerin und und und (s. hier unter I. M. Hülbusch und Inge Meta Hülbusch). Alle diese Themen könnten auch unter der großen Überschrift „Spurensicherung“ versammelt werden, weil es bei allen darum geht, etwas verstehen zu wollen.
Im Verlauf der Vorbereitungen zum Symposium 2016 wurde das Thema ‚Subsistenz‘ anlässlich eines heftigen Disputs mit Frau Professor Gerda Schneider aus Wien um den Untertitel ‚Über die Arbeit‘ ergänzt, weil es unsere Diskussion viel besser zum Ausdruck bringt. Die Themenfindung entstand aus den Gedanken und der Kritik an der Einvernahme der einfachen Selbstversorger- und Hauswirtschaftsgärten in die Eventkultur und das Städtemarketing in Form von ‚Urban gardening‘, Selbsterntegärten, ‚essbarer Stadt‘ usw. … . Propagiert werden diese modischen Erscheinungen – wie Bernd Gehlken berichtet – mit Subsistenzproduktion, Subsistenzperspektive usw. … . Gemüse- und Obstgärten gab es schon immer und sie hatten tatsächlich mal eine lebenswichtige Funktion. Bernd Gehlken und Bernd Sauerwein berichten, daß ‚Subsistenz‘ ursprünglich den Lebensunterhalt, den Bestand meint. Und damit gehört außerhalb der Erwerbstätigkeit eine Menge an Nebenher dazu, wie K. H. Hülbusch es in der Einführung zum Thema beschrieben hat. Es ist der Haushalt mit Wäsche flicken, Kochen, Backen, Putzen, Aufräumen, Reparieren, Nachbarschaftshilfe, Kindererziehung – wie Petra Arendt berichtet. Das Gärtnern wie der Haushalt fangen, wie Hannah Arendt schreibt, immer wieder von vorne an, aber das Produkt liegt beim Gärtnern, weshalb die ‚Subsistenzdebatte‘ wohl immer wieder an den Möhrchen fest gemacht wird und nicht an der täglichen Arbeit. Das hat uns bewogen den Unter-titel des Symposiums für dieses Notizbuch als Titel ‚Über die Arbeit‘ zu nehmen und groß zu schreiben.
Begegnungen
E. J. Klauck
(2014) A5, ca. 108 Seiten, Beilagen (12,00 Euro/9,00 Abo)
„Autobiographien sind keine unanfechtbaren Autoritäten. Sie sind immer unvollständig. Sosehr ich darauf bedacht bin, die Wahrheit niederzuschreiben, gibt es doch Schwierigkeiten; das Gedächtnis versagt besonders bei gering-fügigen Einzelheiten, so dass am Ende bloß eine Theorie meines Lebens herauskommt, mit vielen Dingen, die vergessen und falsch verstanden wurden, mit wertvol- len Zeugnissen, aber oft nicht ganz wahr, entgegen meiner Absicht, offen und ehrlich zu sein“ (DUBOIS, W. E. B. 1968).
Es ist sicher ungewöhnlich, für einen Autor aber wichtig, wenn man das Angebot von sechzig „Freiseiten“ erhält, die man mit Text füllen darf. Dieses Angebot habe ich von der AG Freiraum und Vegetation / Kassel in 2012 erhalten mit der Option, die Arbeitsergebnisse zu publizieren. Einzige Bedingung: Die AG muss dabei in einem inhaltlichen Zusammenhang stehen. Anlass ist mein zu erwartender 60. Geburtstag am 30.09.2014. Das kommt mir vor, als hätte ich im Lotto gewonnen, als wäre das Angebot gekommen, die Funktion eines Stadtschreibers zu über- nehmen und ich dürfte nun zwei Jahre lang munter drauf los schreiben. Das hat aber auch Bedrohliches, denn 60 Seiten zu füllen ist mitunter eine schwer zu be- wältigende Arbeit. Wir werden sehen, wie ich dieser Aufgabe genüge. Den Titel meiner Erinnerungen und „Gedankengänge“ habe ich mir bei Hans-Dieter HÜSCH entliehen.
Begegnungen und Erinnerungen geraten schnell zu belanglosen Anekdoten. Das wird auch hier nicht zu vermeiden sein, ist aber nicht meine Intention. Mit meinen Erzählungen will ich eher eine Dokumentation über die jeweilige Zeit liefern, eine Darstellung über das, was ich real erlebt habe. Ob das alles anekdotischer Non- sens ist oder den Wert des Bewahrens hat, möge die Leserin und der Leser selbst entscheiden.
Nun, wo fange ich an?
„Soll ich wie die Romanschreiber mit meiner Geburt anfangen oder wie ein Dich- ter mittendrin im Geschehen? Vielleicht weder noch. Ich glaube, ich lasse meine Geschichte an jenem Tag beginnen, … an dem ich die Bekanntschaft…“ (LISS)